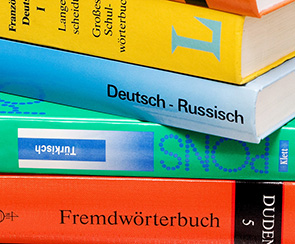
In den Naturwissenschaften hat sich das Englische längst als alles beherrschende Wissenschaftssprache durchgesetzt. In den Sozial- und Geisteswissenschaften scheint der Trend in dieselbe Richtung zu gehen. Doch nicht allen Wissenschaftlern ist dies geheuer. |
Wissenschaft braucht Mehrsprachigkeit!
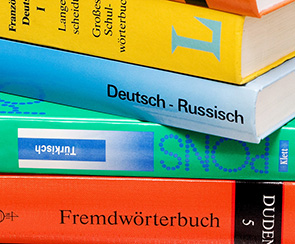 |
Wenn am Vorabend einer Konferenz zum Thema „Wissenschaftssprache Deutsch“ zu einem „Pre-Conference Dinner“ eingeladen wird, muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Damit nämlich, dass hier ein weiteres Mal der Abgesang auf das Deutsche als Wissenschaftssprache angestimmt wird, der in den Laboren und Hörsälen weltweit längst zum standardisierten Repertoire gehört. |
